
Die Tonabnehmer sind bei der Gitarre höchstbedeutend für den Sound. Und es gibt zahlreiche verschiedene. Musikalische Zeitgeschichte haben die sogenannten PAF-Humbucker, die in ihren Anfangstagen die erste Lösung gegen nervendes Brummen waren. Hier die Gründe, weshalb sie damals revolutionäre waren und heutzutage noch immer extrem beliebt sind.
Check it: PAF-Humbucker und ihre speziellen Vorteile
- Wodurch PAF-Humbucker für eine technische Revolution sorgten
- Wie die Nebengeräusche gegenphasig eliminiert wurden
- Weshalb die PAF-Ära als die goldenen Gibson-Ära gilt
- Was Heißlaufen mit dem legendären Sound zu tun hat
- Wieso man nicht auf die Musikerwünsche hören konnte
- Welche Versuche es gab und gibt, Retro-Pickups zu konstruieren
PAF-Humbucker – damals kein Marketingstatement nötig
Die Bezeichnung PAF-Humbucker steht für „Patent Applied For“-Pickups: „Zum Patent angemeldet“. Das klingt jetzt nicht so besonders spannend oder kreativ. Im heutigen Patent- und Produkt-Dschungel wäre das vermutlich kaum noch ein marketingtaugliches Statement. Damals – nämlich 1955 – durchaus. PAF-Humbucker brauchten keinen massenkompatiblen Werbenamen. Sie überzeugten durch ihre sehr speziellen Eigenschaften und sollten bereits unmittelbar nach den Jahren ihrer Entstehung – selbst wenn wir mit solchen Prädikaten vorsichtig umgehen sollten – eine echte Revolution auslösen.


Brummen, Rauschen, Knistern – die nervenden Nebengeräusche
Eines der größten Probleme der Gitarrentonabnehmer waren die immer wieder auftretenden Nebengeräusche, das Rauschen. Bis in die fünfziger Jahre war bei Pickups keine Rede von rauscharm. Vielmehr war die Geräuschentwicklung ein selbstverständliches Ärgernis, mit dem Gitarristen als auch andere Musiker, die ihre Instrumente per Tonabnehmer verstärken wollten, einfach umgehen mussten. Die Instrumente von Fender waren größtenteils mit anfälligen Single-Coils bestückt, die von Gibson hauptsächlich bereits mit doppelspuligen Tonabnehmern, die aber nicht minder rauschanfällig waren.
Was bedeutet überhaupt Humbucker?
Die Bezeichnung Humbucker ist ein Kunstwort, das auf die englischen Begriffe „Hum“ für Summen oder Geräusch und „to buck“ für vermeiden zurückgeht und mit dem zweispulige Tonabnehmer bezeichnet werden. Die Geräusche sollen durch Phasenverschiebung und infolgedessen gegenseitige Auslöschung eliminiert werden. Weiß man erstmal, woher der Name kommt, wird auch deutlich, dass er selbsterklärend ist und mit welcher Zielsetzung Humbucker entworfen wurden.
Gibson wollte dringend als erstes über die Ziellinie kommen
Es war die goldene Ära der Konkurrenz der späteren Gitarren-Giganten. Als umso dringender empfand Gibson das Bestreben, als erster am Markt eine Lösung zu entwickeln. Entwickelt und konstruiert von Seth Lover wurde der PAF-Humbucker 1955 patentiert, prägte von 1957 bis 1961 die goldene Ära der Humbucker und avancierte bis heute zu einem der Dauerbrenner schlechthin. Die Originale sind kaum noch zu bekommen, haben Sammlerwert. Tatsächlich gehören sie zu den begehrtesten Schätzen innerhalb der Gitarrenwelt.
Der Gedanke des gegenphasigen Auslöschens
Technische Kreativität war gefragt, als Seth Lover, einer der Ingenieure von Gibson, mit der Problemlösung beauftragt wurde. Sein prinzipieller Ansatz war es, zwei einspulige Tonabnehmer (Single Coils) gegenphasig und zugleich seriell miteinander zu verbinden. Dadurch – so die Idee – sollte das Brummen und Rauschen der beiden kombinierten Single-Coil-Tonabnehmer gegeneinander neutralisiert werden. Klingt logisch, wieso war niemand zuvor auf eine solche Lösung gekommen?
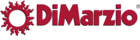

Als die ganze Branche noch in Kinderschuhen lief
Halten wir uns für die Bedeutung der PAF-Humbucker, den Ist-Zustand der damaligen Zeit vor Augen: Eine ganze Branche befand sich noch in den Kinderschuhen, leistungsfähige Verstärker oder gar PA-Anlagen gab es noch nicht. Bei den Verstärkern wurde mit immer stärkeren Trafos experimentiert, was wiederum die Speaker mitmachen mussten, ohne mit der weißen Fahne der Unterwürfigkeit zu wedeln.
Inzwischen kennen wir ja sogar einspulige brummfreie Tonabnehmer wie die Lace Sensor Gold. All das gab es damals noch nicht und wollte erst entwickelt werden. Dabei erblickten zahlreiche Rohrkrepierer das Licht der Welt, aber auch Erfindungen, die Jahrzehnte als Non-Plus-Ultra überdauern sollten. Und eben dazu gehörten und gehören auch die PAF-Humbucker.

Enormer Output von PAR und P90 durch Heißlaufen
Im Grunde sind PAF-Humbucker eine Weiterentwicklung der P90. Diese beiden Typen zeichnen sich durch zahlreiche Gemeinsamkeiten aus; die wohl ausschlaggebendste davon sind die Spulschrauben mit der Eigenschaft, dass diese heiß laufen. Das wiederum bedeutet nichts Geringeres, als dass sie mit enormem Output glänzen. Dabei gehören insbesondere die ersten produzierten bzw. verbauten PAF-Humbucker zu denen, die erstens am stärksten heiß laufen und zweitens damit den maximalsten Output zur Verfügung stellen.
Die spulengewickelte Erfüllung der Möglichkeiten
Das Kuriose in diesem Zusammenhang. Die Wicklungen werden maschinell gedreht; und die Wicklungsmaschine mit von nach Gefühl arbeitenden Angestellten bedienter Wickelstange, die für die PAF-Humbucker genutzt wurde, war zunächst nicht für diese Tonabnehmer gedacht, stattdessen für die P90. Sie kam gewissermaßen gerade recht, um das neue Konzept umzusetzen. Unter dem Strich sprechen wir bei der Herstellung der ersten PAF-Humbucker von einer synergetischen Fertigung, bei der maschinelle Wickeltechnik mit den Erfahrungen und Gewohnheiten der Arbeiter Hand in Hand ging. Für viele Gitarristen waren diese Tonabnehmer die Erfüllung der bis dahin vorhandenen Möglichkeiten.
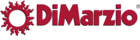

Echt jetzt? Die haben gar nicht gewusst, was sie erfunden hatten
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Gibson selbst sich vermutlich gar nicht über die Bedeutung dieses genialen Schachzugs bewusst war. Die Industrialisierung, Automatisierung und Modernisierung, die über die Jahre eben auch im Instrumentenbau stattfand, ließ den auf der Erfahrung der Hersteller basierenden Zufallsfaktor bei der Wicklung nach und nach verschwinden. Mit diversen Neuerungen wie etwa dem Wechsel der Beschichtung hatte man sich – nein, das ist nicht übertrieben – selbst wegmodernisiert.
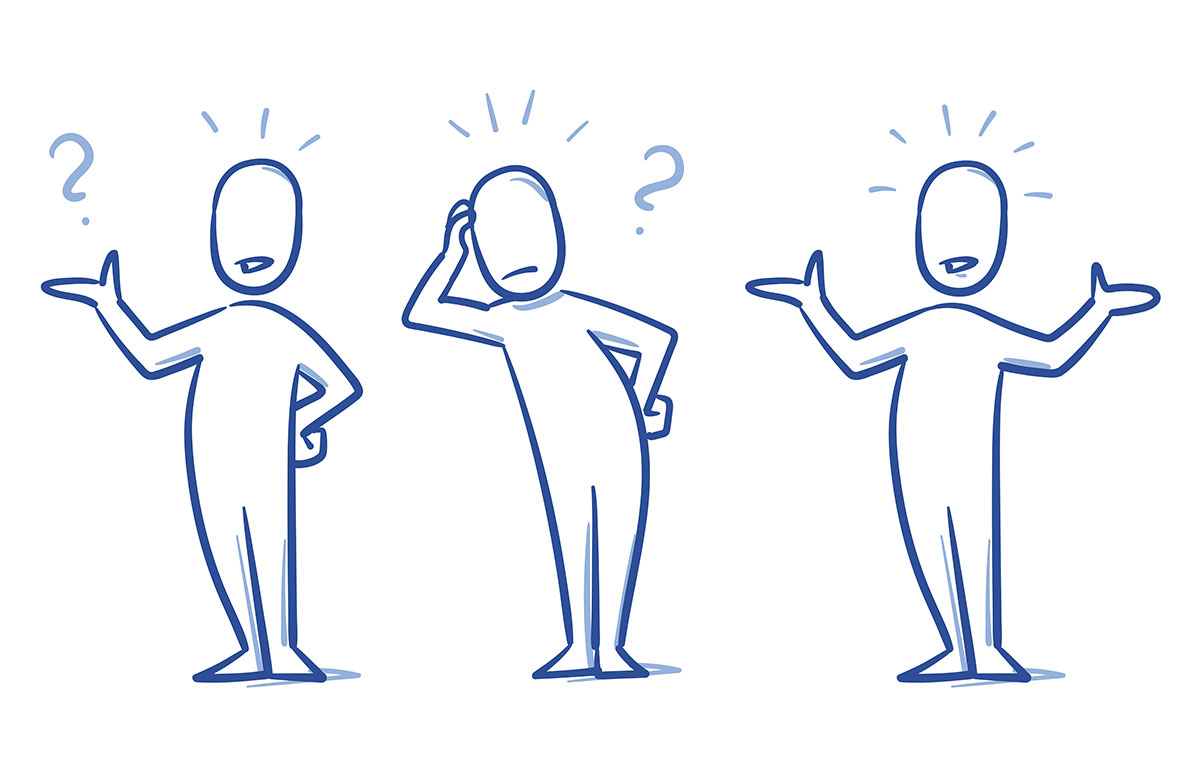
Betriebswirtschaft machte aus Feuer eine schwelende Glut
Je mehr Gibson zum betriebswirtschaftlich handelnden Konzern wurde, umso deutlicher ging die Ära und Aura der PAF-Humbucker den Bach runter. Übrigens zum Unmut der Musiker, die für eben genau diese Tonabnehmer aus den besagten Gründen die Hände ins Feuer gelegt hätten. Aus dem Feuer wurde eine allenfalls minimal schwelende Glut. In der Folge verloren eben auch die Gitarren selbst an Beliebtheit, zumal sich ein Referenz-Sound etabliert hatte, der jedoch mit den neueren Modellen nicht mehr wirklich authentisch verfügbar war.
Gibsons Vorstellungen entsprachen nicht denen der Musiker
Das reichte soweit, dass Gibson Qualitätsprobleme angedichtet wurden, die teils so gar nicht vorhanden waren. Viele Musiker, die weniger technisch veranlagt waren, konnten den Grund nicht wirklich definieren. Manche glaubten sogar ganz banal, irgendwas an dem Instrument oder der internen Verdrahtung sei kaputt. Dabei klangen sie einfach nicht mehr wie die ersten Modelle und Serien. Wie so viele andere Anbieter hatte Gibson sich Innovationen und Modernisierung auf die Fahne geschrieben. Die Musiker nicht. Die wollten ihren Sound mit all seinen Vorzügen behalten, wie er war.
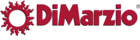

Voller Wehmut denken Gitarristen an die „goldenen Jahre“
Und so wird die Zeit von 1957 bis 1961 auch als die „goldenen Jahre“ von Gibson bezeichnet. Exakt das war die Zeit, in der PAF-Humbucker serienmäßig sowohl in den Standard- als auch Custom-Shop-Modellen verbaut wurden. Dass Sammler zuweilen einen am Hut haben, ist ihnen selbst bewusst. Die meisten stehen zu dieser Macke auch mit einer guten Portion Stolz. Wer allerdings eine Les Paul aus dem Baujahren 1959 oder 1960 ergattern kann, braucht sich über solche Merkwürdigkeiten keinerlei Gedanken machen. Immerhin gehören sie zu den begehrtesten und auch am teuersten gehandelten Gitarrenmodellen an der Sammlerfront überhaupt.
Einfach aus dem Regal geworfen, wie im Supermarkt
Gibson hatte sich gewissermaßen auf der eigenen Überholspur nach der Ära der PAF-Humbucker in die Moderne verabschiedet, in der etliche Gitarristen noch längst nicht sein wollten. Aber man kennt das ja auch dem Supermarktregal: Hat man für sich das perfekte Produkt gefunden, wird es aus unerkenntlichen Gründen plötzlich wieder aus dem Sortiment genommen.

Fast einen selbstverschuldeten Zusammenbruch produziert
In der nachfolgenden Zeit, wir sprechen etwa von den Jahren 1968 bis 1970, entwickelte Gibson zunächst eine neue Generation von Humbuckern, und zwar die so bezeichneten T-Buckern. Das Erkennungs- und Alleinstellungsmerkmal war ein in der Front der beiden kombinierten Singlecoil-Pickups eingeschweißtes „T“. Die Klangunterschiede waren nicht erheblich, aber vorhanden. Gibsons betriebswirtschaftliches Argument war, dass die T-Bucker deutlich preisgünstiger waren als die PAFs. Die prozentualen Einbrüche nahmen beinahe die Dimension eines Börsen-Crashs an.
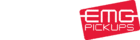

Der nostalgische Retroversuch war nie wirklich schlüssig
Umso schneller wurde der Ruf laut, die Klassiker wieder neu aufzulegen. Gibson musste reagieren, Gibson wollte reagieren; konnte das Vorhaben aber nie wirklich kompromisslos am Original orientiert umsetzen. Ein gewisser Tim Shaw tüftelte und realisierte schlussendlich Modelle, deren Sound sich äußerst nah an den Originalen bewegte; eben insbesondere denen aus den späten fünfziger Jahren.
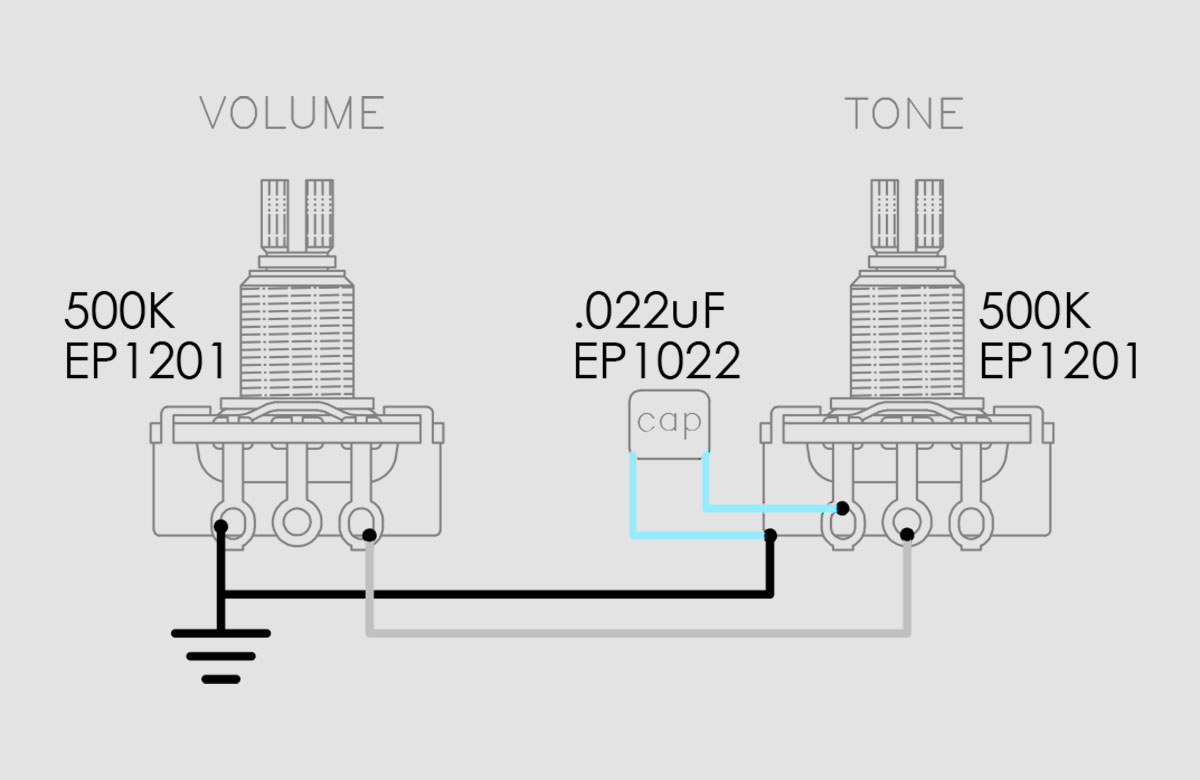
Produziert in Serie wurde für die Masse
Die Firma Gibson konnte die betriebswirtschaftlich fundierte Kalkulation nicht aus den Augen lassen. Der Markt war umkämpft. Da es vergleichsweise wenige Musiker gab, die bereit waren, entsprechende Summen für ihr Trauminstrument auf den Tisch zu blättern, andererseits eine Menge Kaufinteressenten, die sich mit günstigeren Preisen locken ließen, verschwanden die heroischen Pläne wieder in verschlossenen Aktenschränken.


Ein paar Euro mehr hätten Gitarristen glücklich gemacht
Schlussendlich dürfen wir nicht verschweigen, dass es selbstverständlich hochwertige Custom-Shop-Modelle mit oftmals wirklich hervorragenden Pickups von Gibson gibt. Dennoch verbleibt ein gewisses Stirnrunzeln hinsichtlich der Tatsache, dass die Marke bei den normalen Serien, die ja auch nicht ganz preiswert sind, nicht konsequenter auf die kostspieligeren PAF-Humbucker nach altem Vorbild gesetzt haben. Die Musiker haben ja förmlich danach geschrien.
Nostalgie spült kein Geld in wackelnde Kassen
Aufgrund der paar Euro mehr, wäre möglicherweise die eine oder andere Gitarre nicht verkauft worden. Doch das zeitweilig angeknackste Image hätte mühelos und ohne Umwege rasant wieder aufpoliert werden können. Wenn Geiz ist geil über Marktentwicklungen entscheidet, bleibt eine Aura auf der Strecke. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Markt unter extremem Preisdruck stand; wer will es Gibson verdenken, dass sie schlichtweg überleben wollten. Schade ist es trotzdem.
Und noch ein wenig Geschichte für Saitenakrobaten: „Klassiker: Marshall-Amps und der große Siegeszug“.






